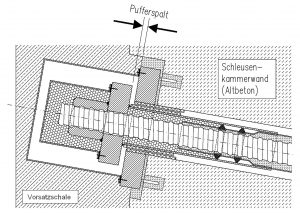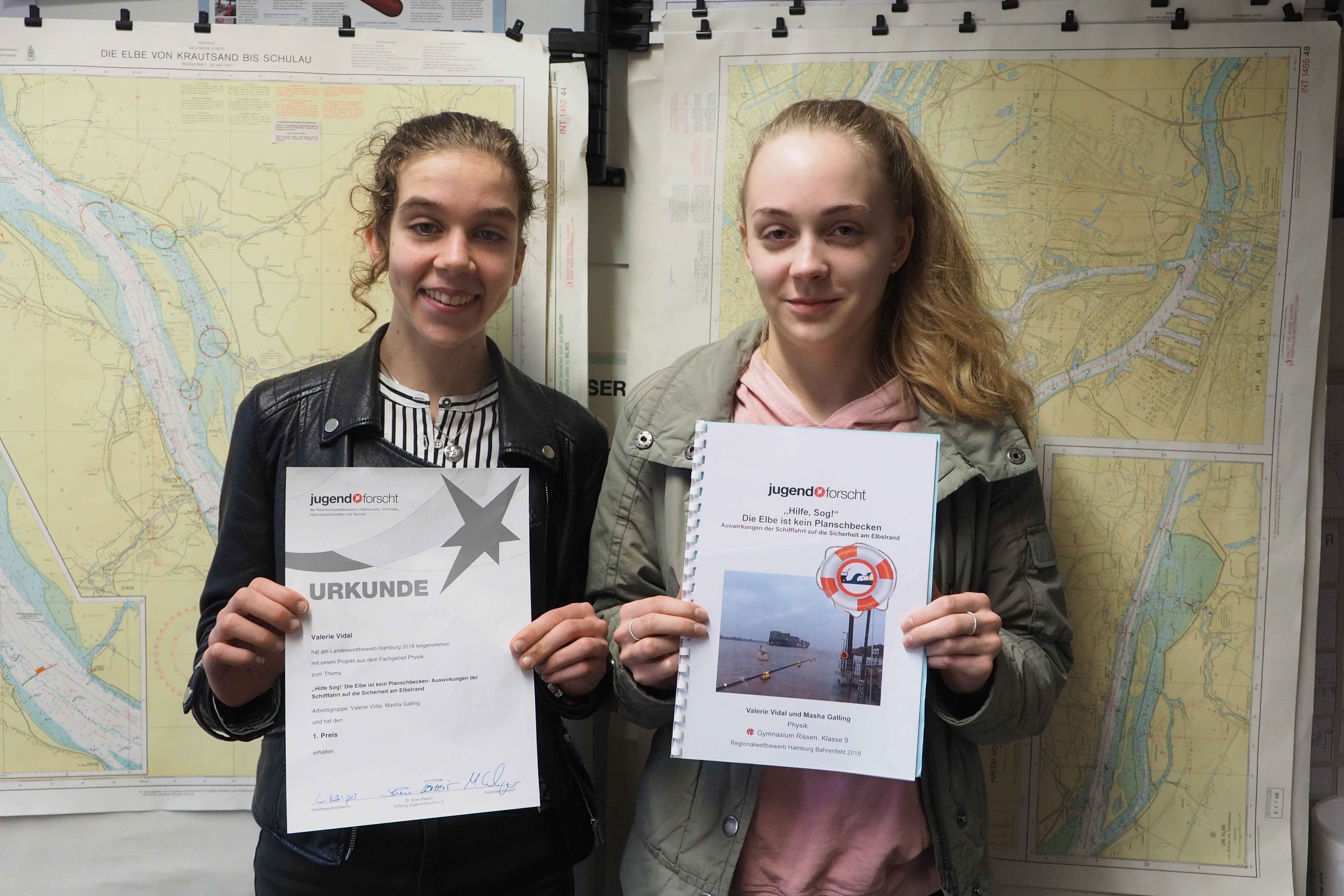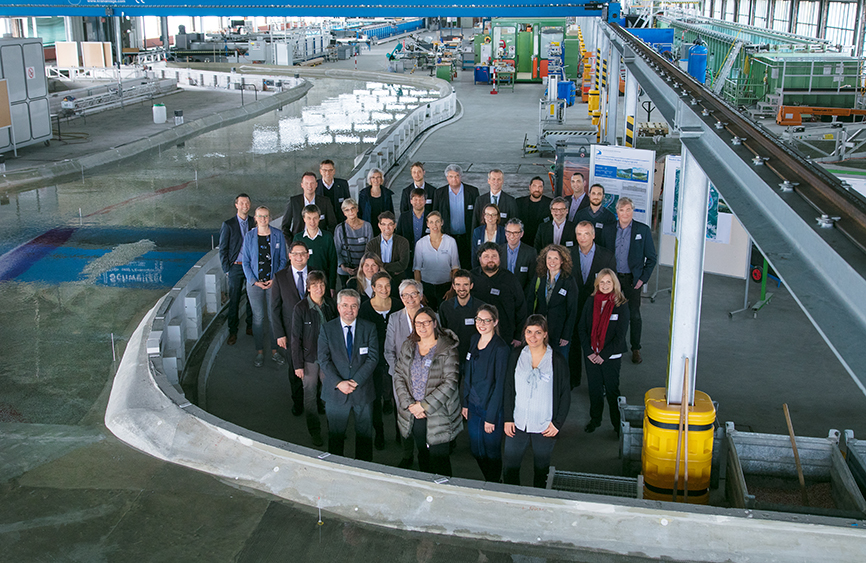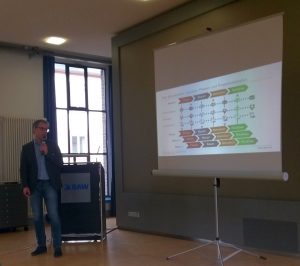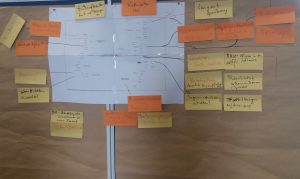Nein, das ist nicht die Geschichte vom kleinen Tiger und dem kleinen Bär, die nach Panama reisen, weil sie eines Tages eine leere Holzkiste mit der Aufschrift „Panama“ aus dem Fluss ziehen, die nach Bananen riecht. Worauf der kleine Bär beschließt, dass Panama das Land seiner Träume ist. Nein, es war nicht der Duft von Bananen, der uns nach Panama lockte, sondern der Duft vom 34. Weltkongress von PIANC, eine der ältesten technisch-wissenschaftlichen Vereinigungen im Bereich Schifffahrt, Häfen und Wasserstraßen. Dieser Kongress fand vom 7. bis 11. Mai in Panama City statt, in unmittelbarer Nähe des Panamakanals, der nach dem Suezkanal, wichtigsten Wasserstraße der Welt.
Die Franzosen hatten sich schon an dem Kanal versucht, als Panama noch zu Kolumbien gehörte. Ferdinand de Lesseps wurde 1880 beauftragt nach dem er bereits erfolgreich den Suezkanal gebaut hatte. Doch Lesseps scheiterte. Malaria, Gelbfieber und das tropische Klima rafften seine Arbeiter dahin. Am Ende kostete der Panamakanal fast 22.000 Menschen das Leben. Ferdinand de Lesseps wollte den Kanal (wie in Ägypten) ohne Schleusen bauen. Als das nicht funktionierte, beauftragte er Gustave Eiffel mit der Planung von Schleusen, doch da war es schon zu spät. Die Kosten für den Kanal waren explodiert und das Unternehmen ging pleite. Beruhigend für die jungen Wasserbauingenieure ist an dieser Geschichte, dass man Ferdinand de Lesseps trotz seinem grandiosen Misserfolg ein Denkmal in Panama City errichtet hat. Also, Mut zum Fehler! Daraus wird man/frau nicht nur klug, sondern man/frau bekommt unter Umständen auch ein Denkmal.
Nach der Pleite von Lesseps kam Theodor Roosevelt, kaufte die französische Konkursmasse auf und verhandelte mit Kolumbien über eine Wasserstraße. Da die Gespräche nur schleppend voran kamen, unterstützte Roosevelt eine Revolution, der souveräne Kleinstaat Panama wurde ausgerufen und von den Amerikanern flugs anerkannt. In einem Vertrag wurde den Amerikanern auf unbegrenzte Zeit die Souveränität über einen 15 km breiten Streifen quer durch das Land zugesichert. Ein guter Deal. Denn mit dem Kanal sollte sich nicht nur der Seeweg von San Francisco nach New York um 15.000 km verkürzen. Panama sollte sich auch für die Amerikaner als ein wichtiger Militärstützpunkt entwickeln.
Dem US Corps of Engineers gelang es die Malaria einzudämmen und den Einschnitt durch die Basaltberge, den sogenannten Culebra Cut, zu überwinden. Einerseits durch Abtrag, anderseits durch den Aufstau des Gatúnsees. Der Höhenunterschied von 26 m erforderte aber auch den Bau von je drei Doppelschleusen. Am 15. August 1914 fuhr der Dampfer SS Ancón als erstes Schiff in knapp zehn Stunden durch die etwa 80 km lange Wasserstraße. Von Panama City im Pazifik bis nach Colón im Atlantik. Im Jahre 1999 gaben die USA schließlich den Kanal zurück, der Panama heute dank der Einnahmen des Kanals zu den reichsten Ländern in Lateinamerika machte.
Soviel zum Hintergrund des Veranstaltungsortes. Was gibt es von der Konferenz zu berichten? Bereits am Sonntag fanden erste Sitzungen der verschiedenen PIANC Kommissionen statt. Um 18 Uhr wurden die Teilnehmer im Rahmen einer Welcome Reception begrüßt, bevor die Veranstaltung am nächsten Tag feierlich vom PIANC-Präsidenten Geoffroy Caude eröffnet wurde. Mehr als 650 Teilnehmer lauschten den Keynotes. Eine Keynote befasste sich dabei mit der Rolle des Panamakanals im internationalen Güterverkehr. So erfuhren die Teilnehmer, dass der Hauptnutzer des Kanals mit Abstand die USA ist, die so ihre Waren von der Ost- an die Westküste bringt und umgekehrt. Dahinter sind China, Kolumbien, Japan und Südkorea weitere große „Kunden“. Interessant ist auch, wie der Suezkanal und der Panamakanal konkurrieren. Da der Suezkanal zeitweise die Gebühren um 65% gesenkt hat, haben einige Reedereien sogar den längeren Weg über den indischen Ozean und das Mittelmeer vorgezogen.
Bis Donnerstag jagte dann, in sechs parallelen Sessions, ein Vortrag den anderen. Die BAW leistete mit insgesamt sieben Vorträgen ihren Beitrag zum Programm, das insgesamt sehr breit gefächert war. Neben „Inland Navigation“ gab es Vorträge zu den Themen „Ports“, „Marinas“, „Dredging“, „Environment“ sowie „Logistics und Infrastructure“. Zahlreiche Vorträge befassten sich mit der Erweiterung des Panamakanals, die ursprünglich zum 100. Geburtstag des Kanals abgeschlossen sein sollte. Bei den Arbeiten gab es aber technische Probleme, so dass das erste Schiff der Postpanamax-Klasse erst am 26. Juni 2016, also zwei Jahre später als geplant, die neuen Schleusen passieren konnte. Neben dem fachlichen Input bot sich in den Pausen der Konferenz die Gelegenheit, bestehende Kontakte zu pflegen, neue Kontakte zu knüpfen und interessante Fachgespräche zu führen.
Zum obligatorischen Konferenzdinner wurde zum Unglück der mehr als 650 Teilnehmer (und vermutlich der Veranstalter) der chinesische Botschafter in Panama eingeladen. Der Botschafter sprach in fließendem Spanisch mit englischer Übersetzung. Das alleine verdoppelte schon die Redezeit. Nach 20 min wurden die Gäste unruhig, nach 40 min fand die Exzellenz immer noch kein Ende. Endlich, endlich kam der Botschafter zum Schluss und bedankte sich artig unter tosendem Applaus (wahrscheinlich waren alle dankbar, dass die Rede beendet und das Buffet endlich eröffnet war).
Am Donnerstag wurde eine Exkursion zu den alten Miraflores-Schleusen auf der pazifischen Seite angeboten. Zwei direkt aufeinanderfolgende, etwa 33,5 m breite und 327,6 m lange, Schleusenkammern überwinden hier, je nach Tide, einen Höhenunterschied zwischen 13 und 20 m. Die Schiffe werden über beidseitig fahrende Treidelloks in die Schleusenkammern gezogen und in ihrer Lage stabilisiert. Dabei können die Loks sogar die 45 Grad steilen Rampen zwischen den Schleusenkammern überwinden. Beeindruckend ist die Koordination der 4 bis 8 Loks durch den Lotsen für eine sichere (und hoffentlich berührungsfreie) Passage der Schiffe.
Im Gegensatz dazu werden die Schiffe in den neuen Schleusen mit Tugboats in die Kammern gezogen und auf Kurs gehalten. Die 4.400 PS starken Kraftprotze begleiten die Schiffe nicht nur durch die Schleusen, sondern teilweise auch durch die Kanalabschnitte mit engen Kurvenradien. Diese neuen Schleusen bekommen wir bei einer Exkursion am Freitag zu sehen. Mit einem historischen Zug der Panama Canal Railway Company werden die Teilnehmer nach Colón gefahren, um dort die Gatún-Schleusen zu besichtigen. Bei der Erweiterung wurden nämlich sowohl auf der atlantischen als auch auf der pazifischen Seite neue, dreistufige Schleusentreppen gebaut, deren Kammern je 55 m breit und 427 m lang sind. Im Gegensatz zu den alten Schleusen wurden diese aber als Sparschleusen mit je drei Sparbecken pro Kammer ausgelegt.
Es ist beindruckend, die Schiffe auf dem Gatúnsee zu sehen, die auf die Einfahrt in die neuen Schleusen warten. Mehr als 14.000 Container fassen die schwimmenden Riesenlager und unsere Binnenschiffe, mit denen wir uns täglich beschäftigen, werden im Vergleich dazu immer putziger. Jährlich fahren rund 15.000 Schiffe durch die Passage. Panama soll mit der Kanalgebühr ungefähr 8% seines Bruttoinlandproduktes verdienen. Das ist großer, wirklich sehr großer Verkehrswasserbau hier in Panama. Ein perfekter Rahmen für den 34. Schifffahrtskongress von PIANC im Land der Träume vom kleinen Tiger und dem kleinen Bär.
Verfasst von Michael Gebhardt
Ich bin seit 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Wasserbau im Binnenbereich und beschäftige mich vorwiegend mit hydraulischen Fragestellungen an Wasserbauwerken.
- Web |
- More Posts(1)









 Photo aus: https://www.jugend-forscht.de/projektdatenbank/hilfe-sog-auswirkungen-der-schifffahrt-auf-die-sicherheit-am-elbstrand.html
Photo aus: https://www.jugend-forscht.de/projektdatenbank/hilfe-sog-auswirkungen-der-schifffahrt-auf-die-sicherheit-am-elbstrand.html