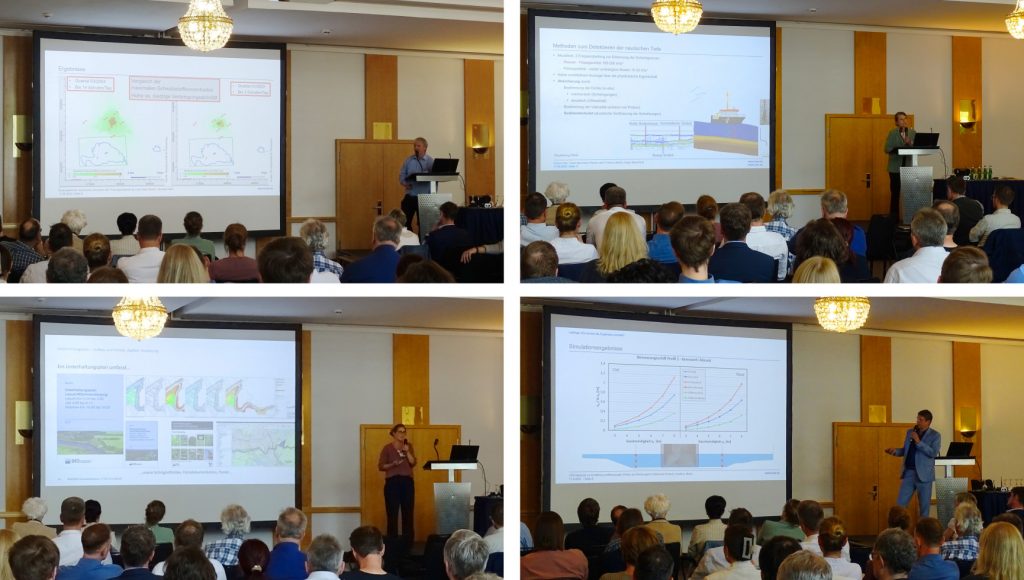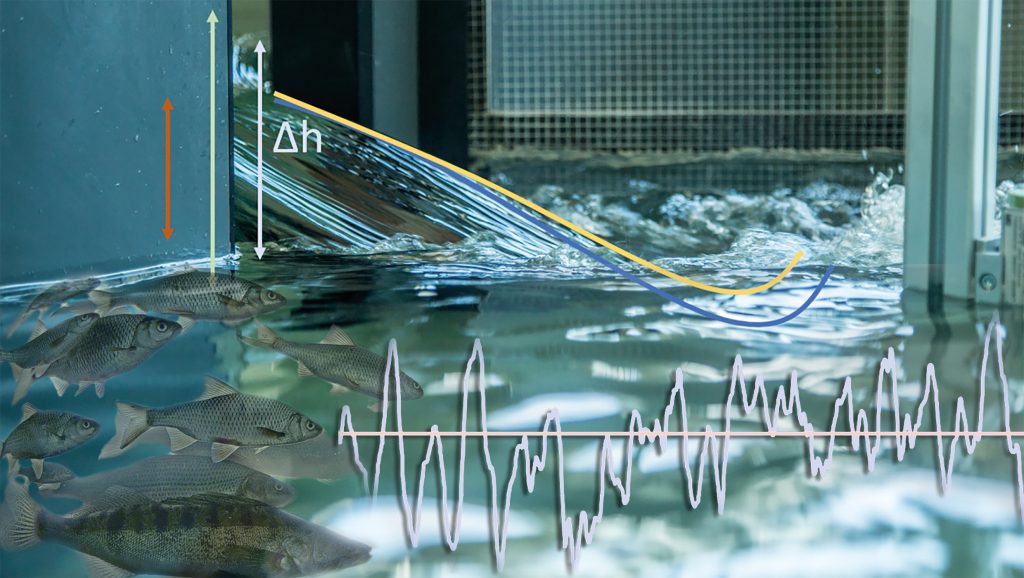Am 18. September 2025 fand in Hamburg wieder das Schiffbautechnische Kolloquium der BAW statt. Für den SNEM-Bereich der WSV (SNEM = Schiffbau, Nachrichtentechnik, Elektrotechnik und Maschinenbau) ist es immer wieder ein Highlight und so haben auch dieses Jahr wieder viele Teilnehmer aus WSV aber auch anderen Bundesbehörden und Institutionen daran teilgenommen. Der Leiter des Referats Schiffstechnik der BAW Benno Lenkeit begrüßte die Teilnehmer zur Eröffnung des Fach-Kolloquiums Schiffbautechnik.
Der folgende erste Vortrag war ein Update zu einem Beitrag aus dem vorangegangenen Kolloquium. So referierten Stephan Klimek und Lars Hoffjann von der Fachstelle für Maschinenwesen Südwest in Koblenz, Sachgruppe „Bündelungsstelle Schiffbau Binnen“ zu den fortgeschrittenen Erprobungen und Erfahrungen mit dem batterie-elektrisch angetriebenen Arbeitsschiff Typ Spatz, kurz genannt „E-Spatz“. Anschaulich legten sie dar, dass die geplante und realisierte Antriebskombination vollumfänglich den Anforderungen entspricht, insbesondere die Größe/ Kapazität des gewählten Batteriepacks, wie die Erfahrungen aus der Praxis nun zeigten. Insgesamt hat sich der E-Spatz bewährt und kann als Vorlage für weitere Neubauten im Binnenbereich der WSV dienen.
Im zweiten Vortrag stellte Ulf Kleine von der Fachstelle Maschinenwesen Nord in Rendsburg die Auswertung von realen AIS- Daten im Rahmen einer Machbarkeitsanalyse für den Einsatz elektrisch angetriebener Lotsenboote im Bereich des Nord-Ostsee-Kanals vor, um die optimale Kapazitätsgröße für ein erforderliches Batteriepack von neuen Lotsenversetzbooten zu finden, die im Anschluss positiv angeregt und ausführlich diskutiert wurde.

Ein Novum bei diesem Kolloquium war ein Vortrag der niederländischen Kollegen von Rijkswaterstaat. Bas Meermann zeigte in seinem Vortrag das Equipment der niederländischen „WSV“ für das sichere Handling mit Fahrwassertonnen, veranschaulicht mit zahlreichen Videos. Insbesondere die Tonnenbearbeitung mit dem A-Galgen am Heck des Schiffs führte zu munteren Diskussionen bei den Teilnehmern des Kolloquiums.

Abgerundet wurde das Kolloquium mit einem Vortrag zum aktuellen Sachstand der Brennstoffzellentechnologie für Schiffe von Frederic Moeris von Freudenberg E-Power Systems in München. Hier wurde aufgezeigt, inwieweit die Technik fortgeschritten ist, um in Zukunft Brennstoffzellen als Range Extender auf Schiffen einsetzen zu können. In seinem Vortrag ging er zudem auf Raumbedarfe, Randbedingungen für den Einsatz und auf erwartbare Kosten ein. Auch dieser Vortrag regte zu Rückfragen und Diskussionen aus dem Kreis der Zuhörer an. Insbesondere Fragen, ab wann mit einsatzprobten Brennstoffzellen zu rechnen ist, zeigte das insgesamt große Interesse an dieser zukunftsorientierten Technologie.

Am Ende der Veranstaltung gab es noch eine Slido-Umfrage, in der um das aktuelle Meinungsbild der Gäste zum Kolloquium allgemein, seiner fachlichen Ausgestaltung sowie zu einer ggf. zukünftigen (Neu)Ausrichtung des schiffbautechnischen Kolloquiums der BAW gebeten wurde. So viel steht schon mal fest: das Kolloquium wird von den Teilnehmern sehr gern angenommen und soll in jedem Falle erhalten bleiben. Viele der Teilnehmer sehen es als Möglichkeit für überregionale und persönliche Treffen von Vertretern der SNEM-Fachbereiche der WSV und benachbarter Bundesverwaltungen. Gegenseitiges Kennenlernen, lebendiger Wissenstransfer, Come together und Networking stehen zwischen den Vorträgen in entsprechenden Pausen im Vordergrund.
Zusammenfassend lässt sich festhalten -das 11. Schiffbauliche Kolloquium der BAW 2025- war eine sehr gelungene und erfolgreiche Veranstaltung mit einem gutes Format um Erfahrungsträger und „Newcomer“ innerhalb der WSV und über die Grenzen hinweg in diesem speziellen Arbeitsbereich -Wasserfahrzeuge- zusammenzuführen. Besonders wurde von den Gästen auch die tolle Veranstaltungsstätte mit besonderem Blick auf Hamburg und die Elbphilharmonie gelobt.
Verfasst von Jörg Kasper
- Web |
- More Posts(1)