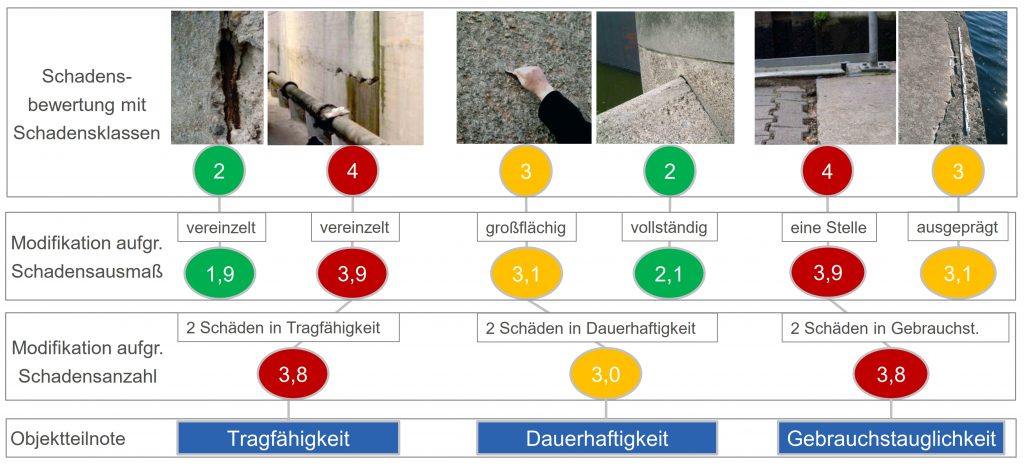Die internationale Fachkonferenz versammelte rund 300 Expertinnen und Experten aus sechs Kontinenten – direkt am Ufer des Mississippi, dem wohl berühmtesten Binnenfluss der Welt. Das diesjährige Motto “Resilient Waterways – Navigating a Sustainable Future” passte perfekt zu den Themen, mit denen wir uns bei der BAW täglich beschäftigen.
In Vorträgen, Diskussionsrunden und persönlichen Gesprächen stellte unser Team aktuelle Forschungsergebnisse vor, teilweise gemeinsam mit der WSV. Dabei ging es um Themen wie die Nachrechnung von bestehenden Bauwerken, Digitalisierungsansätze für das Betreiben der Infrastruktur und die Unterstützung der Schiffahrt sowie Einflüsse des Klimwandels. Während der Konferenz fanden auch Arbeitsgruppensitzungen zu den beiden PIANC-Working Groups 255 (Nachrechnung bestehender Bauwerke) und 264 (Innovative Digitalisierungs-Ansätze für das Infrastrukturmanagement) statt – beide werden von BAW-Kolleginnen geleitet.
Neben dem fachlichen Input blieb auch Zeit für Networking etwa mit Rijkswaterstaat (NL), Voie navigable de France (F) und dem United States of America Corps of Engineer (USA) sowie natürlich den einen oder anderen Blick auf den „Old Man River“. Der Austausch mit internationalen Fachkolleginnen und -kollegen zeigte einmal mehr: Viele Herausforderungen sind global – und lassen sich am besten gemeinsam lösen.
Unser Fazit: Die Smart Rivers Conference war ein voller Erfolg – inspirierend, praxisnah und bestens organisiert – ein Dank an das Organisationsteam von PIANC USA. Mit vielen neuen Ideen und Kontakten im Gepäck kehren wir zurück und freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe.
Verfasst von Jörg Bödefeld
- Web |
- More Posts(2)