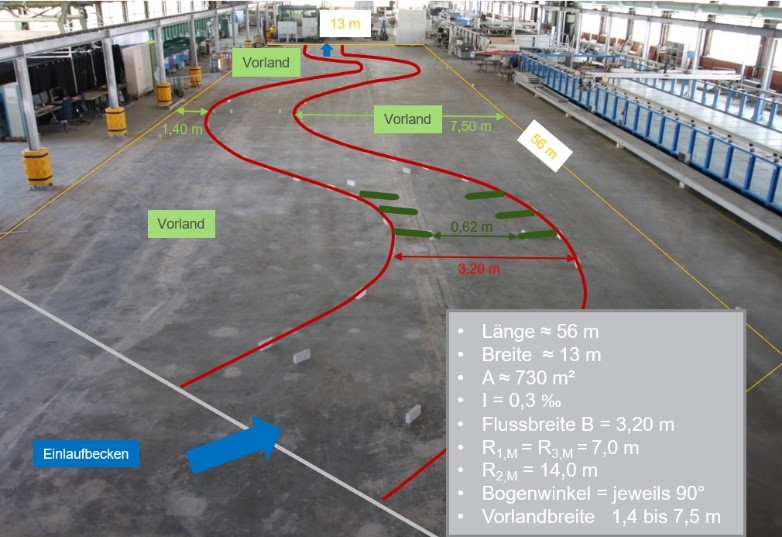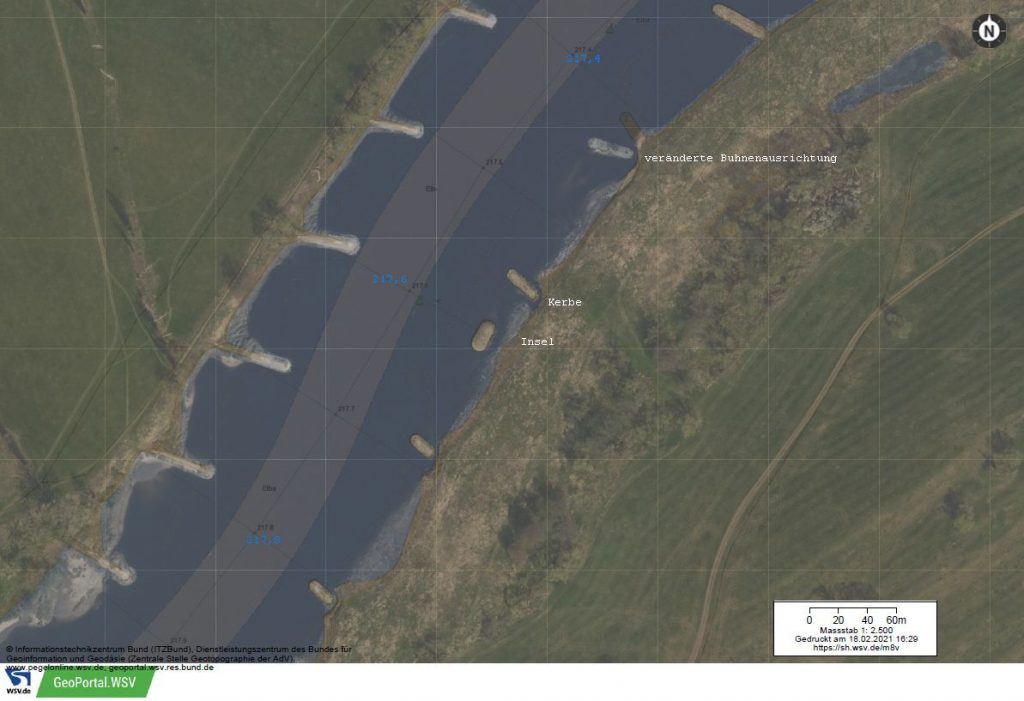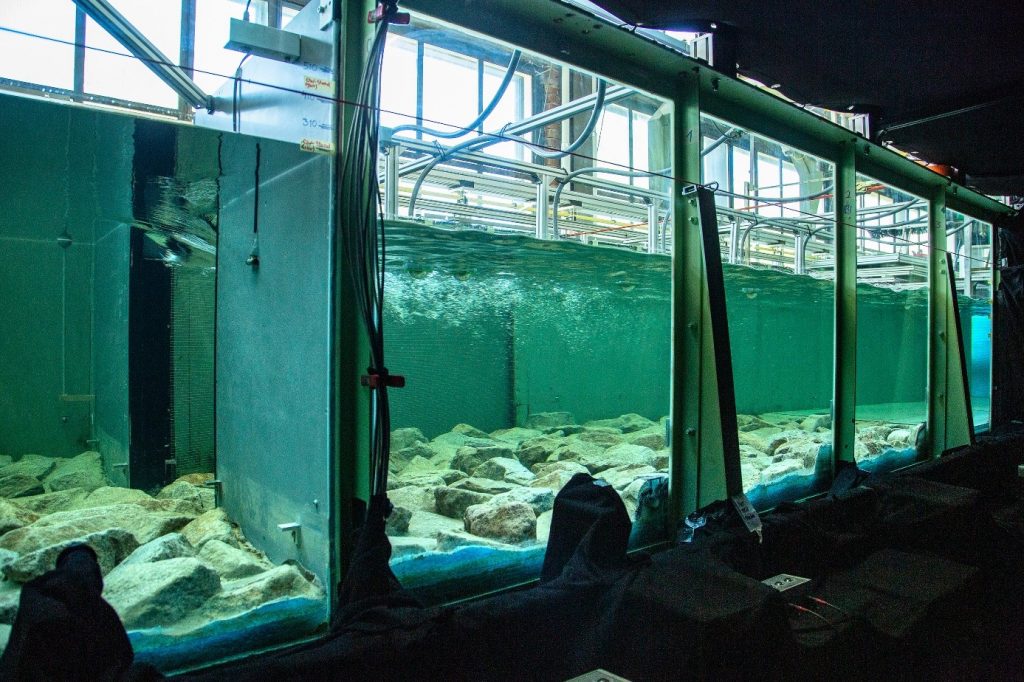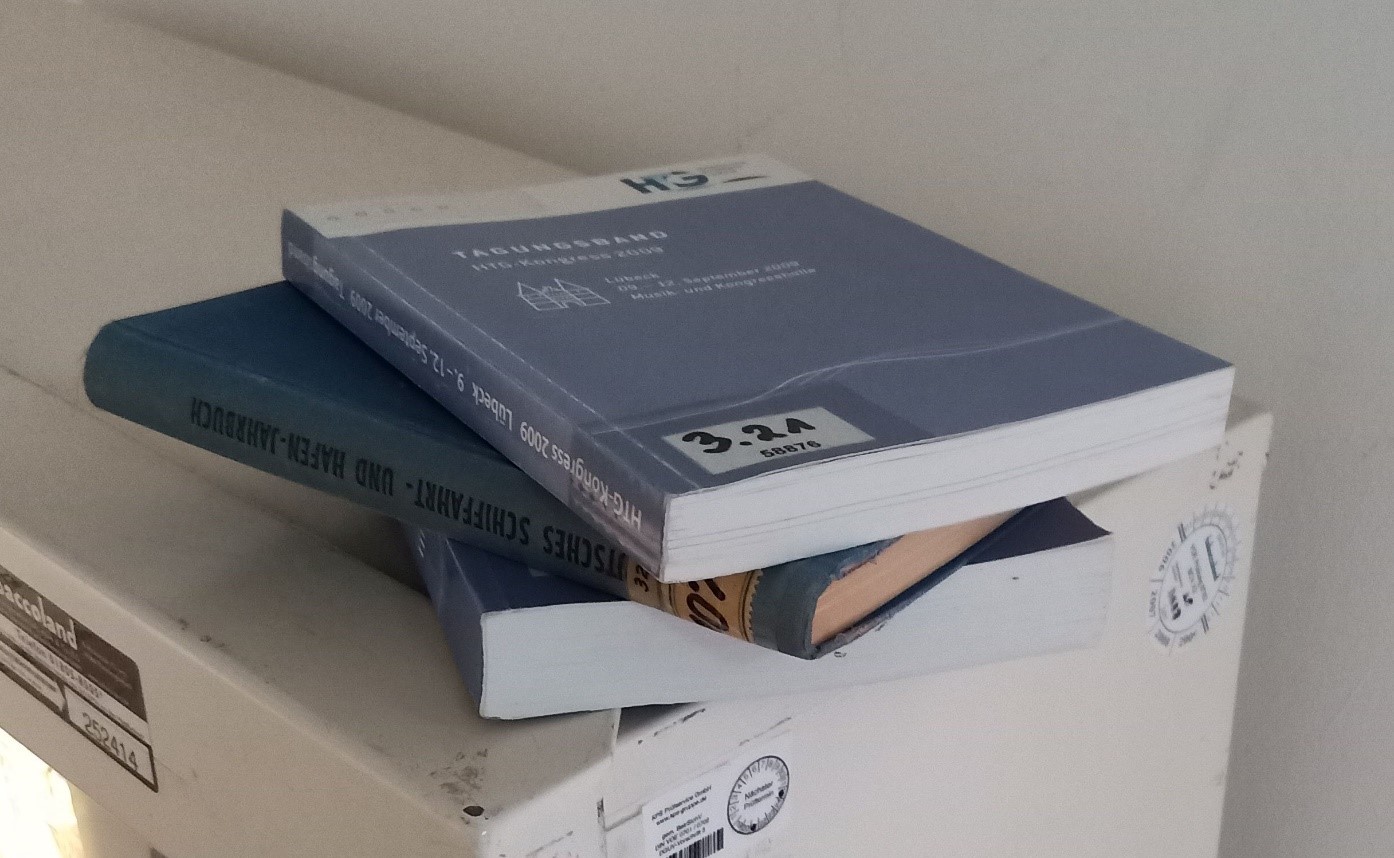Mit der erfolgreichen Zertifizierungserprobung des ersten LNG-Bordnetzaggregates einer 12er-Serie, begleitet von der Klassifikationsgesellschaft Lloyds Register, der BAW und der WSV, wurde ein essenzieller Meilenstein im Konstruktions- und Fertigungsprozess der drei neuen Mehrzweckschiffe erreicht.
Dies ist besonders bemerkenswert, da in den letzten 21 Monaten ein mit Erdgas betreibbarer Verbrennungsmotor so weiterentwickelt wurde, dass er mit toxischer und explosiver Verbrennungsluft, die bei einem Havariebekämpfungseinsatz im Operationsgebiet des MZS auftreten kann, sicher funktioniert.
Dafür haben die Motorkonstrukteure nicht nur die baulich konstruktiven Aggregate-Anpassungen durchgeführt, sondern im Vorfeld Versuche und Messungen an einem Testmotor realisieren müssen.
Auch die Nachbildung der im realen Schiffseinsatz besonders kritischen explosiven Umgebungssituation musste zur Vorbereitung der Werkserprobung betrachtet und in die Bordnetzaggregateerprobung integriert werden. Nicht zuletzt waren hierfür die baulichen Gegebenheiten am Motorprüfstand und auch der laufende Fertigungsbetrieb bzgl. des sicherheitstechnischen Umgangs mit explosiver Verbrennungsluft zu berücksichtigen.
Für den nunmehr ersten Motor dieser neuen hochkomplexen und ausrüstungsintensiven LNG-Mehrzweckschiffe hat alles auf Anhieb funktioniert. Die erforderlichen Nachweise konnten erbracht werden. Für die nun folgenden Aggregate wünschen wir den vertraglich und fertigungstechnisch verantwortlichen Firmen MTU und BERGEN-Engine auch weiterhin gutes Gelingen.
Für das in Norwegen bereits gebaute und erfolgreich erprobte Bordnetzaggregat bzw. die noch zu bauenden drei Einheiten für das erste MZS schließen sich nun zunächst der Transportweg nach Litauen (Klaipėda), zum Zwecke des Einbaues in den Schiffskasko an. Im weiteren Projekt-/Fertigungsablauf wird der vorausgerüstete Schiffskasko, nach Deutschland (Lemwerder) verschleppt. Dort wird aus dem vorausgerüsteten Kasko ein modernes und hochkomplexes Mehrzweckschiff, dessen Systeme, wie auch die Bordnetzaggregate nach Abschluss der Installationsarbeiten einer Inbetriebnahmeprozedur und weiterer Hafen- und Seeerprobungen unterzogen werden. Anschließend kann das Mehrzweckschiff dem in 2021 neu gegründeten Reedereizentrum der WSV übergeben werden.
P.S. Durch die zwischenzeitliche Herauslösung des Motorfertigungswerkes aus dem Rolls-Royce-Konzern gehören sowohl der gebaute als auch die noch für die Mehrzweckschiffe zu bauenden LNG-Motoren zu den letzten, die ein Rolls-Royce-Typenschild erhalten werden.
(erstellt: Ulf Türmer, Referat K4, Fachbereich Elektrotechnik)
Bildquelle: BAW